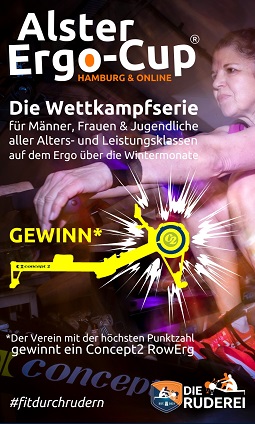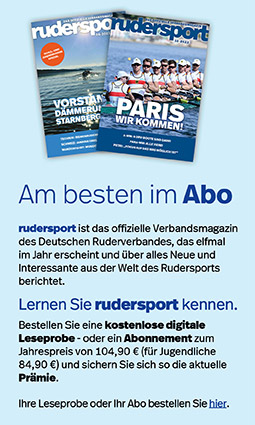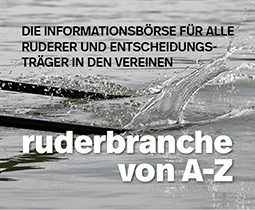Langhanteltraining im Krafttraining etabliert
Langhantelübungen, die man über den kompletten Bewegungsumfang absolviert, sind der funktionelle Ausdruck der menschlichen Skelett- und Muskelanatomie unter Belastung. Jede Übung wird bestimmt und limitiert durch die individuellen Bewegungsmuster eines Sportlers, die ihrerseits durch viele Faktoren wie die Länge der Gliedmaßen, Muskelform, Kraftniveau, Flexibilität und neuromuskuläre Effizienz definiert werden.
Langhanteln bringen den Sportler außerdem dazu, verschiedenste kleine Anpassungen vorzunehmen, die notwendig sind, um während der Übung die Kontrolle über die Hantel zu behalten. Dies kann mit Kraftmaschinen nur unzureichend simuliert werden. Die frei bewegliche Last erfordert und aktiviert über den gesamten Bewegungsablauf hinweg eine Vielzahl unterstützender Muskeln.
Die Langhantel hat sich in vielen Sportarten als Trainingsmittel im Krafttraining etabliert. Ein gezieltes Krafttraining erfordert die Beherrschung der Technik, die bereits im Kindesalter zwischen 9-12 Jahren mit Besenstil oder Plastikstab erlernt werden kann. Das Training mit der Langhantel hat folgende Vorteile:
- Besonders effiziente Trainingsform: Sehr viele Muskelgruppen sind beteiligt.
- Effektives Training: Große Fortschritte in wenigen Wochen
- Große Wirkung auf Knie-/ Hüft-/ Schultergelenksstabilität und Haltung
- Hoher Anteil an Koordination u.a. Gleichgewicht
- Hohe Bedeutung des Zentralen Nervensystems: Muskeln werden gezielt angesteuert
Welche Langhantelübungen können im Training der Kinder und Jugendlichen Anwendung finden?
Basisübungen
Kniebeuge vorne
Kniebeuge hinten
Lastziehen / Kreuzheben
Bankdrücken
Rudern vorgebeugt / Bankziehen
Schulterdrücken
Je früher die Langhanteltechnik erlernt wird, desto sicherer kann sie später angewendet werden und desto besser kann sie in das Leistungstraining integriert werden.
Auf was sollte im Langhanteltraining geachtet werden?
Neben einer guten technischen Instruktion muss vor großen Belastungsschritten in kurzer Zeit gewarnt werden: Qualität vor Quantität! Ein Langhanteltraining und auch die Einführung in diese Trainingsform ist hochkonzentriert und diszipliniert durchzuführen – der Trainer ist immer dabei!
Gregor Ortmann
Die original-Heftseiten können Sie sich >>HIER (PDF) anschauen